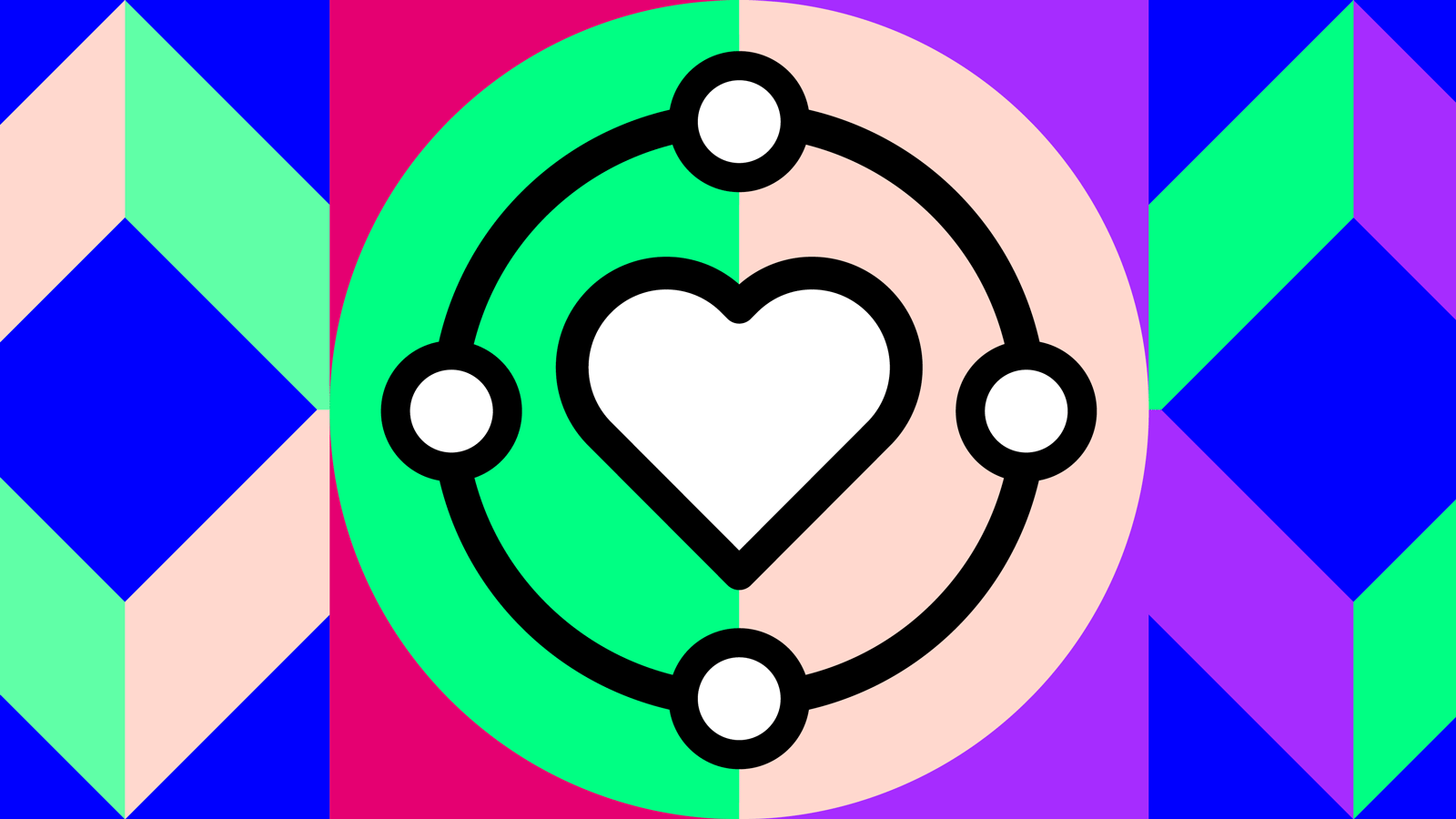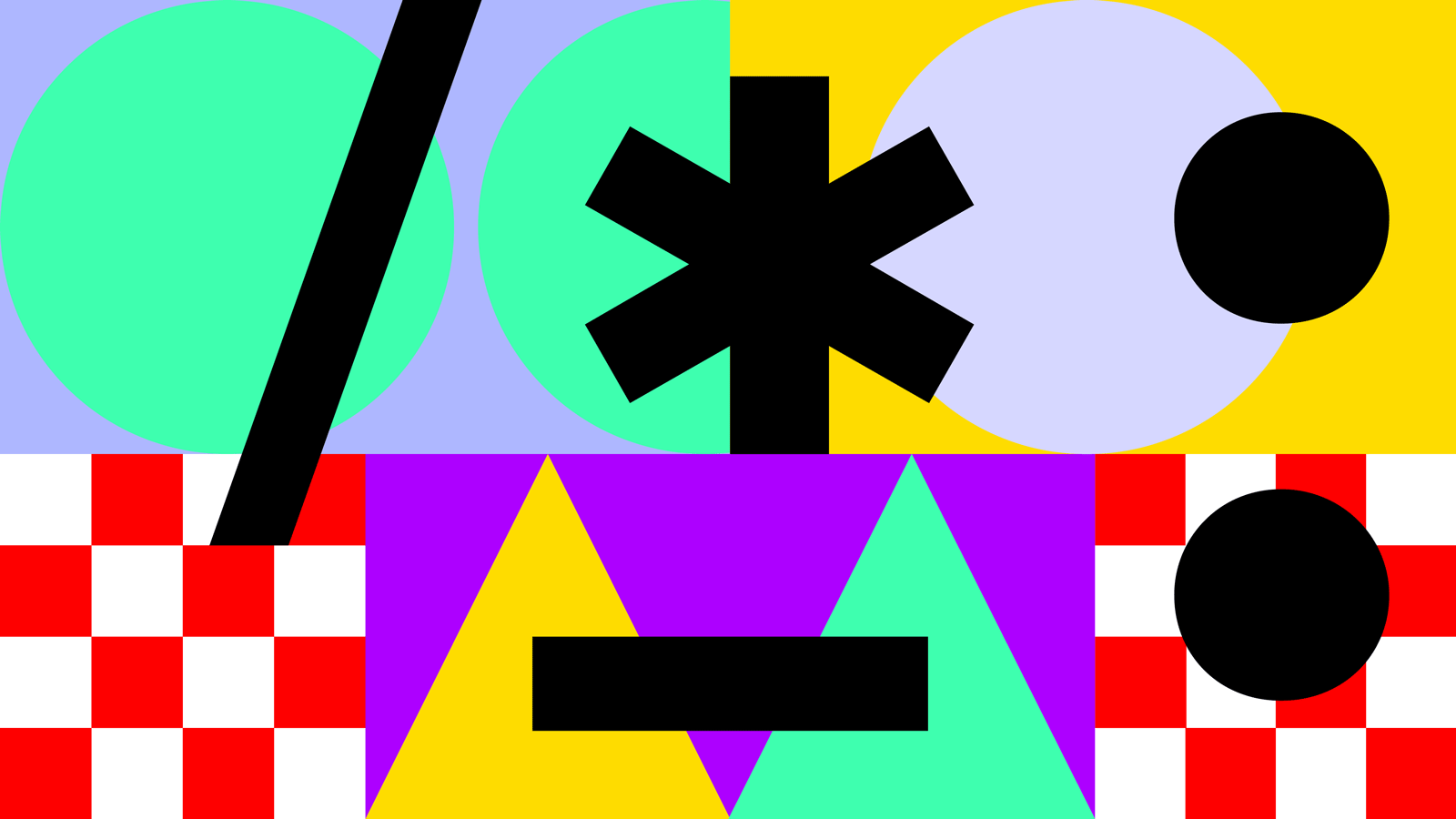Intersektionalität
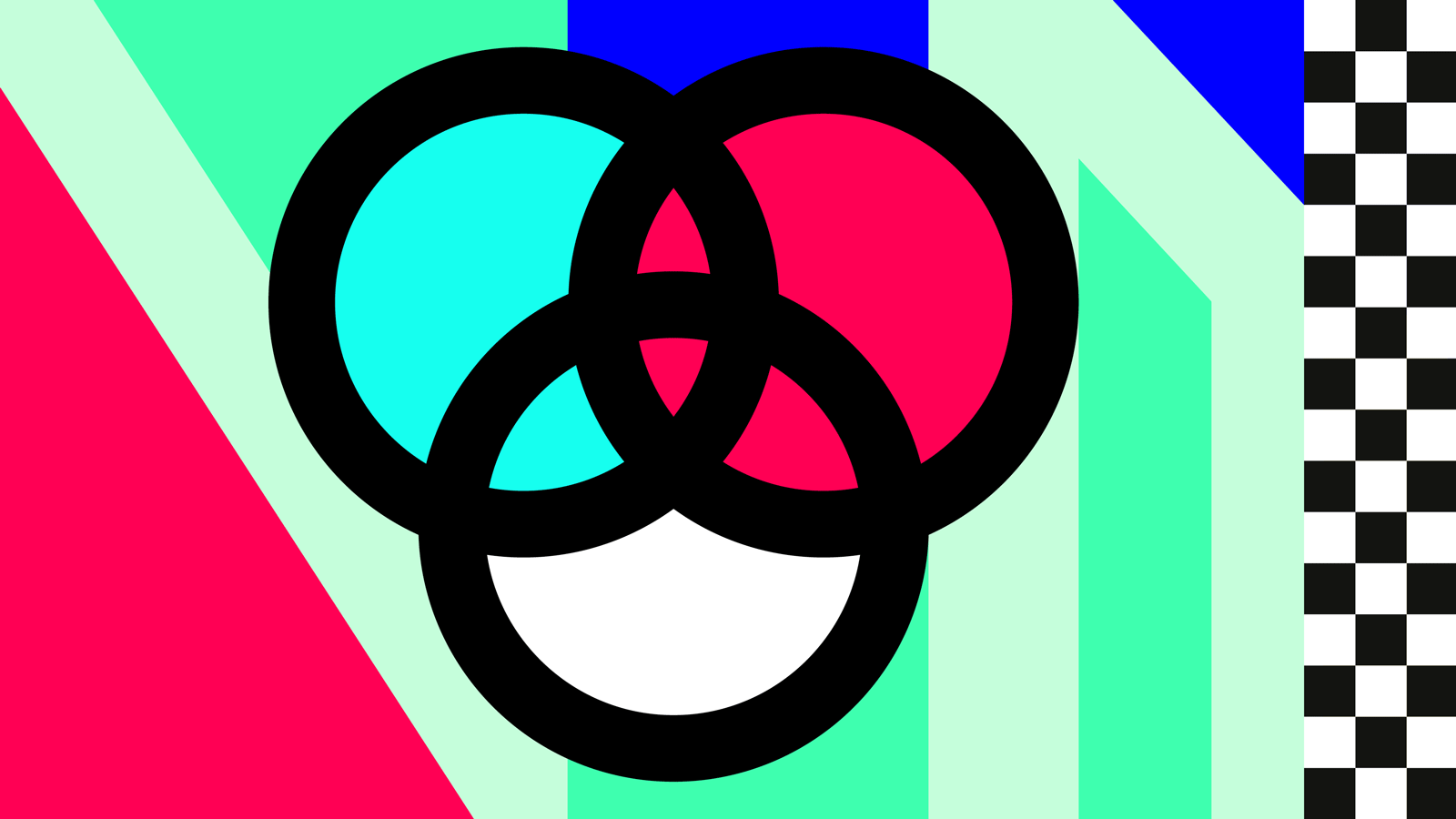
Auf den ersten Blick scheint die Gruppe der Personen, an die sich das Angebot des Mädchen*treffs richtet, bis auf die Altersunterschiede, homogen: Mädchen* und junge Frauen* zwischen 9 und 21 Jahren. Hier ist es naheliegend, ähnliche Bedürfnisse zu unterstellen und standardisierte Vorstellung des Mädchen*-Seins zu entwickeln.
Doch dieser erste Blick kann fatale Folgen haben, denn es ist wertvoll und wichtig darüber nachzudenken, wie die Vorstellung einer vermeintlich homogenen Gruppe, Zwang, Normierungsprozesse und Ausschluss generieren kann.
Schnittmengen von Diskrimierungen
Es steht fest: Die Mädchen* und jungen Frauen* im Mädchen*treff sind unterschiedlich verschieden und machen mannigfaltige Erfahrungen aufgrund ihres Geschlechts. Mädchen* of Color oder Mädchen*, die Hijab tragen, erleben Sexismus anders als weiße Mädchen*. Disableisierte Mädchen* leiden unter patriarchalen Strukturen anders als ableisierte Mädchen*. Mädchen*, die trans sind, leiden unter anderen Diskriminierungen als cis Mädchen*. Mädchen*, die unter der Armutsgrenze leben, werden mit anderen Vorurteilen konfrontiert und anders benachteiligt als Mädchen* aus wohlhabendem Elternhaus.
Es wird also deutlich, dass innerhalb einzelner Personen Schnittmengen von Diskriminierungen sichtbar werden können und diese verantwortlich sind für Platzierungsprozesse in der Gesellschaft sowie, daran anknüpfend, unterschiedliche Chancen, Privilegien, Risiken, Zugänge zu Ressourcen und Handlungsspielräumen.
Grundlegend dafür ist die Erkenntnis, dass wir die Strukturkategorien unserer Gesellschaft wie Geschlecht, Ethnizität, Klasse, sexuelle Orientierung etc. nicht isoliert betrachten dürfen, sondern im Zusammenspiel analysieren müssen. So geht es um das Zusammenwirken von verschiedenen Mechanismen, die soziale Ungleichheit produzieren – allerdings nicht einfach in einer additiven Gestalt, sondern in Form von Verschränkungen.
Theorie und Praxis der Intersektionalität
Die Theorie, die hinter dem Wunsch steht, multiple Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnisse ermitteln zu können, heißt Intersektionalität und wurde geprägt von Kimberlé Crenshaw (1991). Ihr Ziel war es, den Fokus auf die komplexen Wechselwirkungen zu legen, die zwischen den unterschiedlichen ungleichheitsgenerierenden Differenzkategorien existieren.
Durch eine intersektionale Perspektive wird vermieden, die Gesamtheit an zugrundeliegenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen außer Acht zu lassen.
Deswegen müssen wir uns gegen alle Formen von Unterdrückung und Diskriminierung wehren und gerade die Verwobenheiten darin erkennen.
In der pädagogischen Praxis bedeutet dies natürlich eine gesteigerte Komplexität in Bezug auf den Umgang mit Diskriminierung. Einen Mädchen*treff in jeder Hinsicht zu einem Ort voller Wertschätzung, Vielfalt und gegenseitigem Respekt zu machen, bedeutet daher, konstant normativitätskritisch zu arbeiten und zu reflektieren, durch welche Praxen Mädchen* „zu Anderen“ gemacht werden.
Wenn wir einen Schutzraum bezüglich patriarchaler Strukturen schaffen wollen, dann muss die Frage gestellt werden, ob dieser Raum auch bezüglich anderer Diskriminierungen als „Schutzraum“ fungieren kann. Können Mädchen* offen von Rassismuserfahrungen sprechen, fühlen sich lesbische oder trans Mädchen* willkommen, und inwieweit wird von Pädagoginnen Klassismus reproduziert?
Die vermeintliche Verbindung über die Identifikation mit dem Weiblichen führt noch nicht automatisch zu einem sensiblen Umgang mit sämtlichen anderen Diskriminierungsformen. Um dies zu erreichen, kann jedoch die Theorie der Intersektionalität ein bedeutsames und elementares Analysewerkzeug sein.

Haltung
Antirassismusarbeit
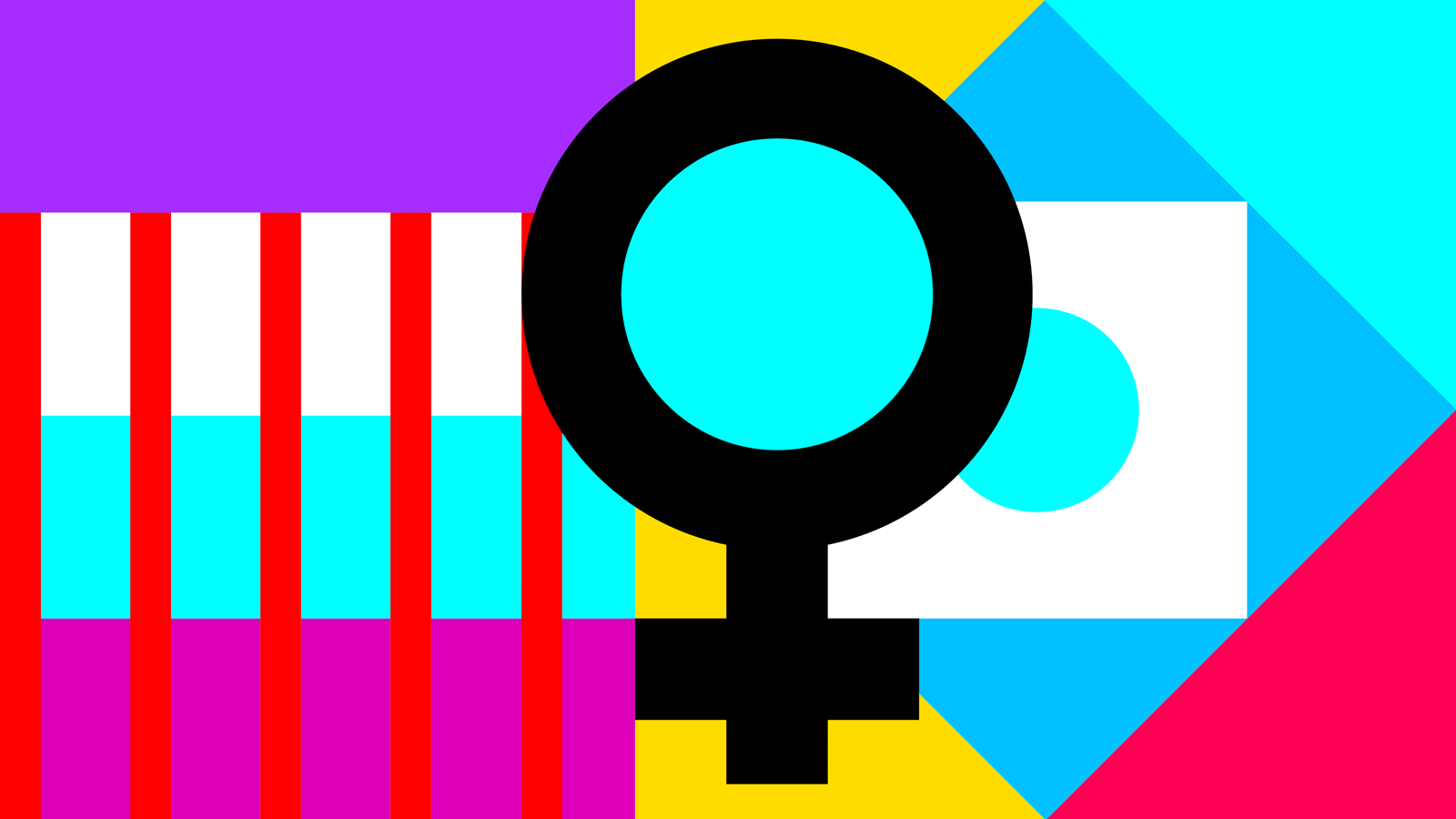
Haltung
Feminismus
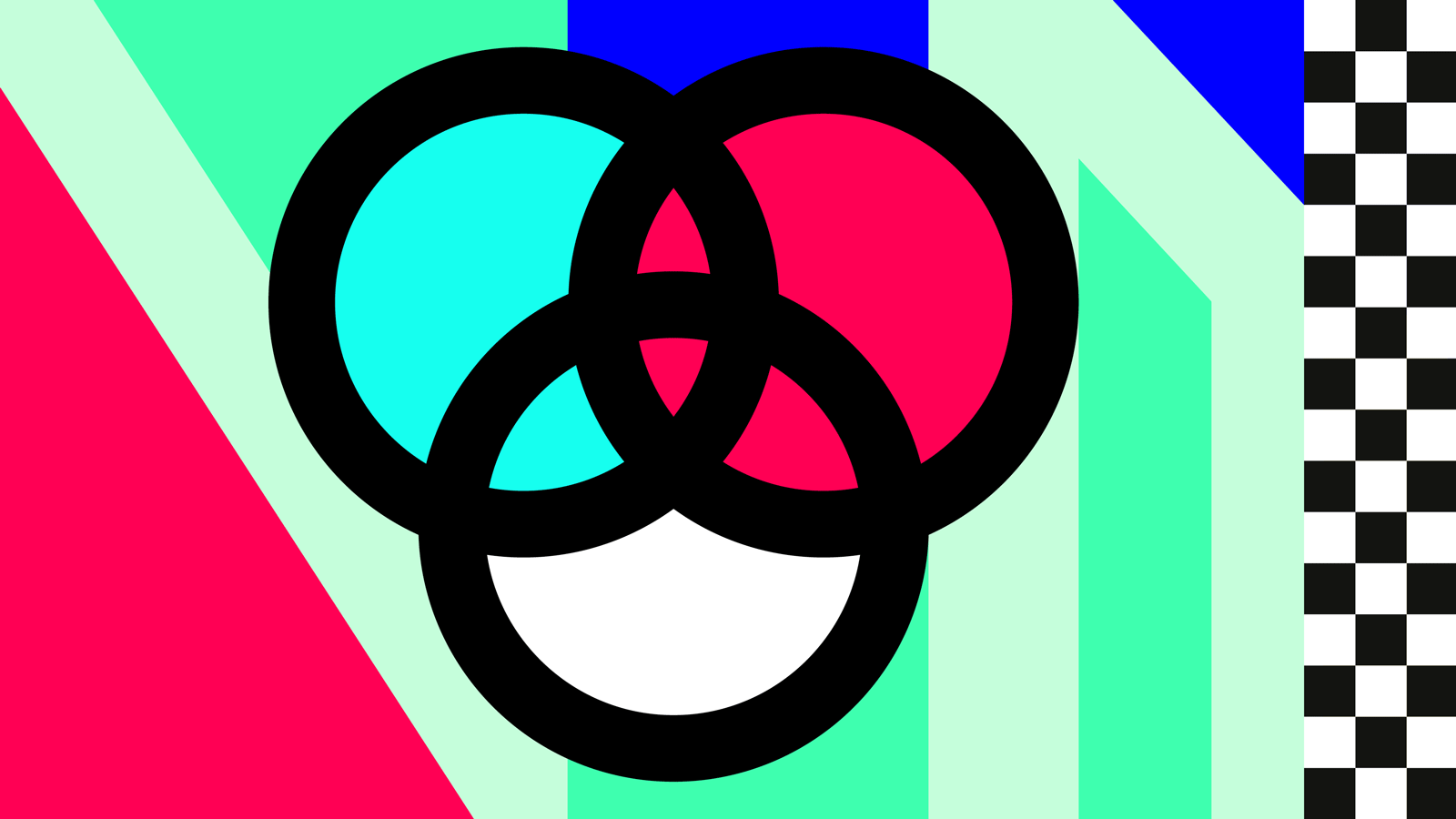
Haltung
Intersektionalität